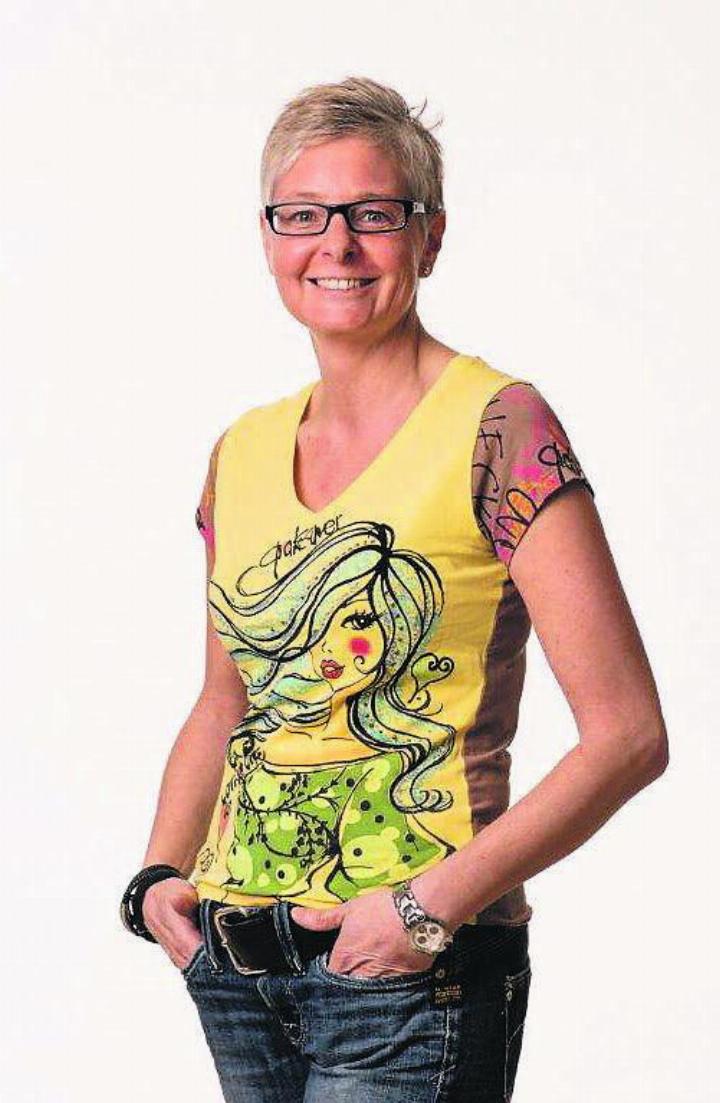Vanessa Sacchet im Gespräch mit Ueli Graf
17.02.2024 Häuslenen, Leute aus der RegionUeli Graf, geboren am 26. Mai 1967 in Frauenfeld, wuchs mit zwei Schwestern auf. Der gelernte Landwirt und Kaufmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit klein auf begeisterte er sich für den Orientierungslauf (OL). Wie es dazu kam, erzählt mir der heute 56-Jährige.
Ueli Graf, geboren am 26. Mai 1967 in Frauenfeld, wuchs mit zwei Schwestern auf. Der gelernte Landwirt und Kaufmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit klein auf begeisterte er sich für den Orientierungslauf (OL). Wie es dazu kam, erzählt mir der heute 56-Jährige.
«Ich war in der 1. oder 2. Klasse als mich mein Vater, der damals über das Militär und später den OL-Club Orientierungsläufe bestritt, mich an einen Lauf mitnahm. Zu Beginn liefen wir in der Familienkategorie und er gab mir Anweisungen. Später als ich alles selbst beherrschte, kontrollierte er mich nur noch. Im OL-Sport gibt es regionale Läufe, die in der Ost- und Innerschweiz stattfinden, und etwa acht bis zehn nationale Läufe pro Jahr. Mit zehn Jahren fuhr ich zum allerersten Mal allein nach Langenthal und lief in der Kategorie Herren 12. Die Anforderungen waren viel höher und der Ablauf sehr speziell. Ich hatte damals Mühe, weil alles neu war für mich. Am Start übernahm ich die Karte, musste die Postenstandorte nicht wie früher abzeichnen. Das war alles sehr professionell und überforderte mich etwas. Ich lief nicht wirklich gut», meint Graf lachend.
Die Kunst des Kartenlesens
«Im Orientierungslauf tritt man einem Club bei. Ohne einen Verein geht dieser Sport nicht. Fast jeder davon bietet Trainings an, und zwar keine Lauf-, sondern Kartentrainings. Es ist das A und O, dass man Karten lesen kann, um die Posten zu finden. Da werden Kompass-Trainingseinheiten angeboten. Mit 13 Jahren kam ich ins regionale Nachwuchskader, wo ich auf professionellem Niveau geschult wurde. In den Jugendjahren lief ich viele Orientierungsläufe. Als ich im besten Alter war, pausierte ich verletzungsbedingt 20 Jahre lang und fing mit 40 Jahren wieder damit an.
An der Weltmeisterschaft (WM) nahm ich erst als Senior teil. Man qualifiziert sich nicht durch Leistung, sondern bezahlt ein Startgeld und meldet sich an. Meistens finden die Weltmeisterschaften in wunderschönen Gegenden statt. Möchte man Weltmeister werden, muss man die Vorläufe überstehen. Da gibt es Qualifikationen. Nur die besten 60 bis 80 Läufer kämpfen dann im sogenannten Finale A um eine Medaille. Da auch ehemalige Elite-Weltmeister teilnehmen, wird die Luft nach oben dünner.
Die Läufe finden hauptsächlich in Wäldern statt. Mittlerweile gibt es auch Sprints in Städten. Diese gleichen sich alle ein wenig. Aber in den Wäldern ist die Topologie und die Eigenschaft jeweils ganz unterschiedlich. Ein extremes Beispiel sind die Nordländer. Finnland ist komplett flach mit Felspartien und Sümpfen. Da muss man schon wissen, durch welchen Sumpf man gehen kann und durch welchen nicht. Man muss im Vornherein mehrmals in einer solchen Gegend gelaufen sein, um die Wälder kennenzulernen.
Die Interpretation auf der Karte zum Objekt im Gelände ist entscheidend. Man muss sich aneignen, die Sumpfpflanzen zu kennen, damit man weiss, wo sich der Rand zum Sumpf befindet. Hat man Ambitionen, irgendwo in der Schweiz an der Spitze mitzulaufen, muss man ein Jahr vorher jeweils in diesem Gebiet trainieren, damit man sich ein Bild vom Gelände machen und sich auf der Karte zurechtfinden kann. Einfach loszurennen und das Gefühl haben, dass es dann schon klappt, funktioniert nicht.»
Trainingseinheiten im Ausland
«Generell werden grosse OL-Veranstaltungen im Ausland etwa drei bis vier Jahre voraus bekannt gegeben. Dann schaut der Club, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Woche vor Ort zu trainieren. Man darf jedoch nicht genau in diesem Gebiet üben, in dem der Lauf stattfindet. Dieses ist bereits Sperrgebiet. In der Nähe gibt es jedoch genügend andere Wälder, die gleich aussehen, wo wir unsere Trainingswoche manchmal zwei bis drei Jahre vor dem Anlass absolvieren, um das Gebiet kennenzulernen. Entscheidend ist, dass man die Karte mit den Geländepunkten sauber interpretieren kann. Auch Bäche mit deren tiefen, damit man weiss, ob man ihn umlaufen oder mittendurch gehen kann. Das sind alles Erfahrungswerte, die man durch das Training gewinnt.
Meine beste WM absolvierte ich in Sestriere, Italien. Da war ich supergut im Langdistanzfinale und wurde Zehnter von etwa 350 Teilnehmern. Auch war ich an den WM-Läufen in Schweden, Norwegen, Tschechoslowakei und zweimal im Baltikum in Estland und Lettland. Im Jahr 2022 war ich nochmals in Süditalien. Das absolute Highlight war jedoch Neuseeland. An den Sprint in Rotorua kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ist eine Stadt auf der Nordinsel und der Sprint findet dort und in den angrenzenden Parks statt. Es regnete enorm viel. Der Seepegel war so hoch, dass er gewisse Wege, die auf der Karte waren, überflutete. Wir starteten und der Veranstalter setzte die Posten tatsächlich mitten ins Wasser. Es waren teilweise sogar Warmwasserquellen, die wir anliefen. Das war genial.»
Unerwartete Hindernisse meistern
«Ein guter OL-Läufer zieht den Lauf voll durch, weil er die richtigen Entscheidungen trifft. Ich bin manchmal unsicher und muss mich während eines Laufs von Posten zu Posten umentscheiden. Mal biege ich falsch ab und mache einen Kompassfehler. Wenn ich von der Idealroute abkomme, muss ich schauen, wie ich wieder auf den richtigen Weg zurückfinde. In einem OL rennt man zwar, denkt aber nicht an das Laufen selbst. Die Gedanken drehen sich andauernd darum, wo man ist, man hindurchlaufen, wo abkürzen kann. Man beschäftigt sich auch mit der nächsten Postennummer und dem entsprechenden Objekt. Ist es zum Beispiel ein Wurzelstock, ein Loch im Wald oder eine Kulturgrenze. Man studiert permanent.
Während eines Laufs merkt man rasch, wenn man an den Anschlag kommt und müde wird. Dann mag das Hirn nicht mehr ganz mit. Am Arm trägt man eine Postenbeschreibung. Dort steht zum Beispiel drauf, dass der nächste die Nummer 24 ist. Das muss ich im Kopf behalten. Es gibt drei Dinge, die ich mir merken muss: die Nummer, in welche Richtung ich nach dem Stempeln vom Posten wegrenne und was für ein Objekt es ist. Bin ich müde, übersäuert und nur 40 Meter vom Posten entfernt, weiss ich die Nummer bereits nicht mehr, wenn ich dort ankomme. Das sind Anzeichen dafür, dass das denken nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Dann gilt es aufzupassen und beim Laufen Tempo rauszunehmen, damit das Hirn wieder mitmag.»
Durch Dickicht und Distanzen
«Dass ich bei einem Lauf umherirre, kommt immer mal wieder vor. Als kleiner Bub weinte ich jeweils, wenn ich mich im Wald verlief. Sobald ich nicht mehr wusste, wo ich bin, suchte ich mir einen gutmütigen Senior, der mir auf der Karte zeigen konnte, wo ich mich befinde. Im Alter nehme ich es gelassener und versuche ruhig zu bleiben. Ich nehme auch nicht jeden OL todernst. Es ist dann halt einfach so, dass man den Fehler einstecken muss und drei Minuten länger für eine Strecke braucht. Dann versuche ich einfach, den Rest gut zu laufen. Es besteht immer wieder die Möglichkeit, sich aufzubauen. Blöder ist es, wenn man einen falschen Posten anläuft.
Wir laufen auch Staffeln mit zwei Teamkameraden oder -kameradinnen. Diese sind darauf angewiesen, dass ich alle Posten fehlerfrei absolviere. Wenn ich mit dem elektronischen Patch einen falschen quittiere, wird die ganze Mannschaft disqualifiziert. Das ist dann bitter. Diese Momente möchte man vermeiden. Mir geht es eigentlich nicht darum, ob ich Erster, Fünfter oder Zehnter werde. Die Eigenleistung und das Optimum herauszuholen, ist entscheidend und das, was einen zufriedenstellt und motiviert. Eigentlich versuche ich den eigenen optimalen Lauf zu finden, was mir letzthin gelang – bis auf einen kleinen Fehler, der mich 20 Sekunden kostete.»
Navigieren zum Sieg
«Der OL findet draussen in der Natur statt. In Schweden sind es bis zu 5000 Läuferinnen. Beim Zieleinlauf auf einer Waldwiese gibt es Verpflegungsstände. Abfall entsteht jedoch nie. Für alle Läufer ist klar, dass jeder einzelne seinen Müll wieder mitnimmt oder zumindest vorschriftsgemäss entsorgt. Das ist sehr beeindruckend. Auch in der Schweiz ist es sehr wichtig, dass man ein gutes Einvernehmen mit der Jagdobhut hat, da wir als OL-Läufer die Wege verlassen. Das wird bei den Jägern und Förstern nicht wirklich gerne gesehen. Deshalb ist es wichtig, sich untereinander abzusprechen. Man grenzt sogar das Sperrgebiet aus, wohin sich das Wild zurückziehen kann. Es ist mir ein Anliegen, dass man achtsam miteinander umgeht.»
Ich frage den passionierten OL-Läufer, was er noch für Ziele hat. Ueli Graf antwortet: «OL bestreiten kann man bis ins hohe Alter. Ich habe einen Kollegen, der mit 90 Jahren zum ersten Mal OL-Weltmeister wurde. Es ist fast ein bisschen vermessen von mir, aber ich träume tatsächlich davon, an einer WM auch einmal auf dem Treppchen zu stehen. Das kann in fünf, zehn oder auch erst in 15 Jahren sein. Klar hat man mit 90 nur noch fünf oder sechs Konkurrenten und nicht 300 oder 500 wie in meiner Kategorie. Das zu erreichen, ist grossartig und nur in ganz wenigen Sportarten möglich. Mein Ziel ist es, gesund und zufrieden zu bleiben und weiterhin viel Freude am Sport zu haben. Das ist das Entscheidende.»
VANESSA SACCHET