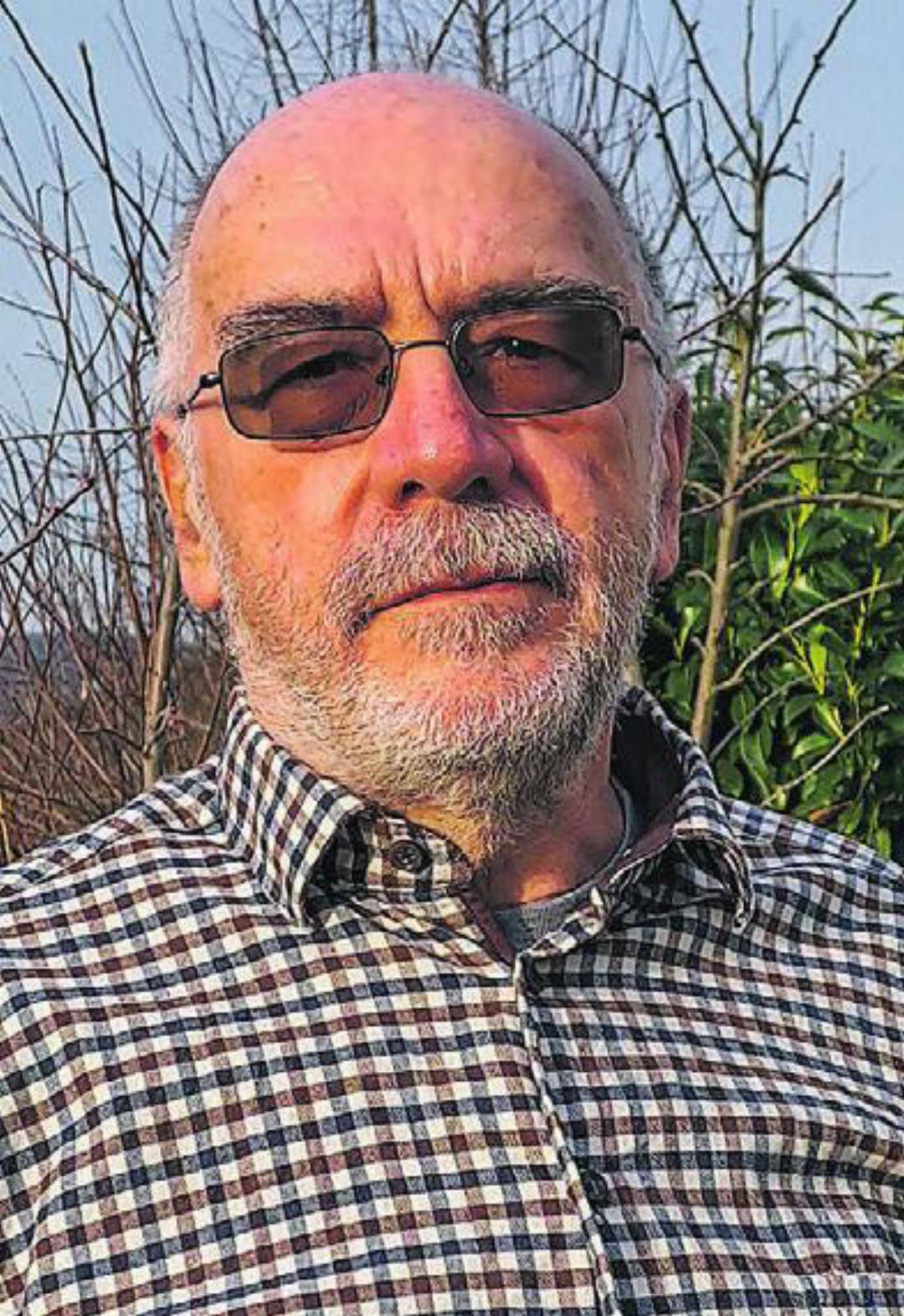Mit 13. AHV-Rente gegen die schwindende Kaufkraft
15.02.2024 AbstimmungenGemäss Initianten der Abstimmungsvorlage haben die Rentnerinnen Jahr für Jahr weniger im Portemonnaie. Alles wird teurer, mit den Pensionskassenrenten geht es nur bergab. Die Gegner sehen keinen finanziellen Spielraum für eine 13. AHV-Rente. Die Stabilisierung des ...
Gemäss Initianten der Abstimmungsvorlage haben die Rentnerinnen Jahr für Jahr weniger im Portemonnaie. Alles wird teurer, mit den Pensionskassenrenten geht es nur bergab. Die Gegner sehen keinen finanziellen Spielraum für eine 13. AHV-Rente. Die Stabilisierung des Sozialwerks und die Sicherung der Renten hätten Priorität.
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ist das Fundament der schweizerischen Altersvorsorge. Mehr als 2,5 Millionen Pensionierte erhalten gegenwärtig eine AHV-Rente. Diese soll den Existenzbedarf im Alter angemessen decken. Die meisten Pensionierten haben weitere Einkommen, insbesondere eine Pensionskassenrente. Wer seinen Lebensunterhalt damit nicht bestreiten kann, hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL).
Die Initiative will die Altersrenten der AHV um eine Monatsrente erhöhen. Sie bestimmt laut Informationen im Abstimmungsbüchlein auch, dass die EL wegen der 13. Rente nicht gekürzt werden darf. Die maximale jährliche Altersrente würde für Einzelpersonen um 2450 auf 31’850 und für Ehepaare um 3675 auf 47’775 Franken steigen. Durch diese Erhöhung würden die entsprechenden Kosten bei der Einführung voraussichtlich etwa 4,1 Milliarden betragen; davon müsste der Bund rund 800 Millionen Franken bezahlen. Danach würden die Kosten schnell weiter zunehmen. Die Initiative, über die am 3. März abgestimmt wird, lässt die Frage der Finanzierung offen.
Verteilung nach dem Giesskannenprinzip
Bundesrat und Parlament sehen keinen finanziellen Spielraum für eine 13. AHV-Rente. Die Stabilisierung des Sozialwerks und die Sicherung der Renten hätten Priorität. Die meisten Pensionierten seien nicht auf eine 13. Rente angewiesen. Für Personen mit geringen Mitteln gebe es gezielt EL. Deshalb lehnen Bundesrat und Parlament die Initiative des schweizerischen Gewerkschaftsbundes ab.
Für das Nein-Komitee ist klar: Die Initiative treibt die AHV in den Ruin. Der ersten Säule drohe ab 2030 das Geld auszugehen. Es brauche deshalb dringend Reformschritte. Die Initiative für eine 13. AHV-Rente führe aber genau zum Gegenteil und verursache zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe. Sie schröpfe zudem den Mittelstand. Zur Finanzierung des AHV-Ausbaus brauche es eine deutliche Erhöhung der Mehrwertsteuer beziehungsweise Lohnabgaben. Das treffe den Mittelstand besonders hart. Die Gegner fordern zudem: keine Zusatzrente für Millionäre. Die Initiative sei unfair und unsozial. Der AHV-Zuschlag werde nach dem Giesskannenprinzip verteilt. Wer bereits eine hohe Rente beziehe, kriege nämlich den grössten Zuschlag.
Das Nein-Komitee wirbt für eine gezielte Erhöhung von tiefen Renten und erinnert an eine im Nationalrat im vergangenen Dezember angenommene Motion. Diese verlange eine Anpassung der Berechnungsformel für die AHV-Renten mit Rücksicht auf tiefe Einkommen. Sie halte aber auch fest, dass der Finanzierungsbedarf dafür nicht höher sei als zwei Prozent der jährlichen Ausgaben der AHV. Der Ständerat hat über diese Motion noch zu entscheiden.
Tragbare Kosten
Die Initiantinnen und Initianten der Vorlage argumentieren mit der schwindenden Kaufkraft der Rentnerinnen. Mieten, Krankenkassenprämien, Strom, Lebensmittel: alles sei teurer. Bei den Löhnen gehe es wieder aufwärts, Rentner würden hingegen im Stich gelassen. Eine 13. AHV-Rente koste die Arbeitnehmenden längerfristig nur 80 Rappen pro Tag. Müsste man denselben Betrag privat – beispielsweise über die dritte Säule – ansparen, wären das dreimal so viel.
Als weiteren Grund für die Lancierung der Initiative führen die Initiantinnen die sinkenden Pensionskassenrenten ins Feld. Seit mehr als zehn Jahren gehe es mit diesen nur noch abwärts. Schuld an deren Zerfall seien die Teuerung und tiefen Zinsen. Die zweite Säule kenne im Unterschied zur AHV keinen Teuerungsausgleich. Deren Verwaltung sei zudem nicht billig. Die Pensionskasse koste jeden einzelnen über 1400 Franken Verwaltungskosten pro Jahr. Die AHV habe diese Nachteile nicht. Mit einer 13. Rente hätten alle wieder mehr Geld zur Verfügung.
Gemäss den offiziellen Finanzperspektiven werde die AHV im Jahr 2026 einen Überschuss von 3,5 Milliarden Franken schreiben. Und die Reserven würden am Ende des Jahrzehnts gegen 70 Milliarden erreichen. Die 13. AHV-Rente koste bei der Einführung jährlich rund 4,1 Milliarden. In dem Jahr würden die geplanten Überschüsse 80 Prozent der Neuausgaben decken. Um die Differenz und den Anstieg der Kosten langfristig zu decken, reichten je 0,4 zusätzliche Lohnprozente von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Für das Initiativkomitee ist klar: Die Kosten sind tragbar.
RENÉ FISCHER
Parolen
Ja: SP, Grüne, AL
Nein: EVP, FDP, SVP, EDU, GLP, Mitte
Pro
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich sage Ja zur 13. AHV-Rente. Und ja, ich benötige sie nicht – mit Betonung auf ich. Weil wir etwas für Wohneigentum auf die Seite legen konnten und uns ein bescheidener Lebensstil gefällt, kommen wir durch mit der AHV und eher kleinen Pensionskassenrenten. Aber ich würde mich freuen über das Geschenk, wie ich mich über die Flasche Wein am Geburtstag oder die Schokolade als Dank für eine Dienstleistung freue. Auch das brauche ich jeweils nicht wirklich, aber es zeigt, dass ich oder das, was ich mache, geschätzt wird.
Im Gegensatz zu den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative kenne ich Rentner, die gerne Zug fahren möchten, es sich aber nicht leisten können oder wollen, weil öffentlicher Verkehr so unverschämt teuer ist. Ich kenne Rentnerinnen, die im Restaurant mit Blick auf ihre finanzielle Lage auf ein Glas Wein oder etwas zum Essen verzichten. Zyniker sagen da: Weder zu viel essen noch Alkohol ist gut für die Alten.
Es ist korrekt, diese Auslagen kosten. Die Bürgerlichen drohen, dass das alles vom Mittelstand bezahlt werden muss, der bereits heute sehr unter den Lebenskosten und Steuern leidet. Aber da drohen die falschen. Es sind die gleichen, die den Unternehmen die Steuern vergünstigen, welche die Kapital- und Erbschaftssteuern abschaffen und das Rentenalter erhöhen. Das sind viel grössere Belastungen als die 13. AHV-Rente.
Das Geschenk an die Rentner ist relativ bescheiden. Es geht um 1225 bis 2450 Franken pro Jahr und Person also 100 bis 200 je Monat. Top-Kader verdienen locker mal 2500 Franken pro Tag. Politiker erhalten jeden Monat Spesenvergütungen in dieser Grössenordnung. Aber ein Senior-Generalabonnement (GA) zweiter Klasse (3040 Franken) oder ein Partner-GA (2860) könnten Rentnerinnen nicht durch die 13. AHV-Rente finanzieren.
Ich meine Ja, geben wir Gegensteuer zu unserer einseitigen Wirtschaftspolitik und lassen wir die Rentner von diesem Geschenk profitieren. Ich verspreche euch, wir geben alles wieder zurück. Sei es durch mehr Konsum oder am Ende durch grössere Beteiligung an den Kosten für das Altersheim.
Kontra
Die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» schiesst über das Ziel hinaus. Eine 13. AHV-Rente ist gerechtfertigt, aber nur für diejenigen Personen, die eine solche auch wirklich benötigen. Rund 85 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner brauchen keine zusätzliche Monatsrente der AHV. Mit dieser Initiative sollen aber im Giesskannensystem selbst sehr wohlhabende Seniorinnen eine zusätzliche AHV-Rente ausbezahlt erhalten.
Die Finanzierung der AHV ist alles andere als gesichert. Deren jährlichen Ausgaben betragen heute rund 50 Milliarden Franken. Eine 13. Rente würde bei der Einführung zusätzlich rund 4,1 Milliarden kosten. Davon müsste der Bund rund 800 Millionen übernehmen. Dieser zusätzliche Beitrag könnte beim Bund zu Einsparungen in anderen wichtigen Bereichen führen. Nach der einführung einer 13. AHV-Rente würden die Kosten zudem sehr schnell weiter ansteigen.
Auch ohne eine solche sind die bestehenden Renten lediglich bis ins Jahr 2030 gesichert. Eine zusätzliche würde die finanzielle Lage der AHV weiter verschärfen und die Zukunft der AHV und somit die Rentensicherheit kommender Generationen ernsthaft gefährden.
Um eine Schieflage der AHV zu verhindern, müssten sowohl die Lohnbeiträge wie auch Mehrwertsteuern erhöht werden. Dies würde zu zusätzlichen Lasten der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter führen. Von den erhöhten Abzügen wären auch Geringverdienende betroffen, die mit finanziellen Mehrbelastungen konfrontiert wären und schlussendlich könnten diese zu weiteren Sozialfällen führen.
Mit einem sozialen Gedanken hat diese Initiative nichts zu tun. Will man die Armut bekämpfen, müssten gezielte Lösungen gesucht werden. Zum Beispiel durch Anpassung der Renten von Personen mit niedrigem Einkommen oder durch höhere Ergänzungsleistungen.
Halten wir unserer AHV sorge und lehnen wir die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» am 3. März mit einem klaren Nein ab.