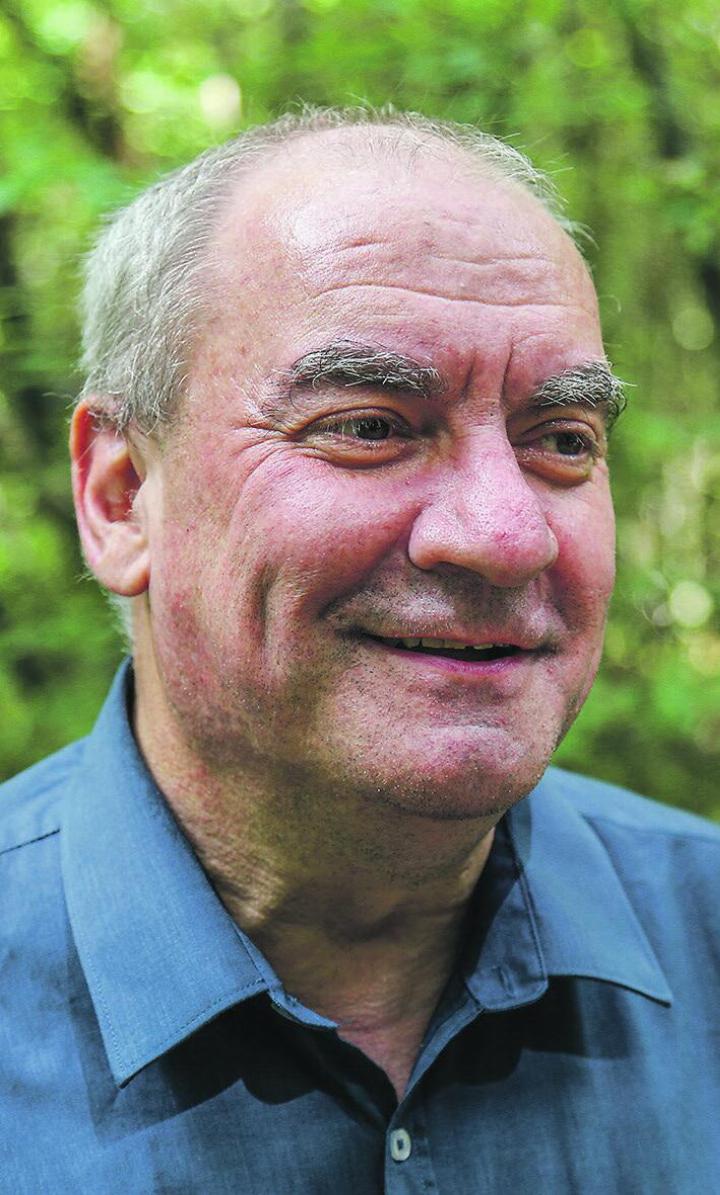Energieholz am richtigen Ort und effizient einsetzen
16.04.2024 RegionAngesichts der stark gewachsenen Nachfrage wächst die Sorge, ob unsere Wälder auch künftig genug Energieholz liefern können. Das Bundesamt für Umwelt BAFU erteilte Holzenergie Schweiz den Auftrag, eine Monitoring-Studie Holzenergie 2023 zu erstellen, um den ...
Angesichts der stark gewachsenen Nachfrage wächst die Sorge, ob unsere Wälder auch künftig genug Energieholz liefern können. Das Bundesamt für Umwelt BAFU erteilte Holzenergie Schweiz den Auftrag, eine Monitoring-Studie Holzenergie 2023 zu erstellen, um den heutigen Verbrauch, die noch ungenutzten Potenziale, die künftigen Verbräuche neuer Projekte sowie die besten Verwendungsstrategien zu klären.
Vorweg stellt Andreas Keel, Geschäftsführer von Holzenergie Schweiz und Autor der Monitoring-Studie Holzenergie 2023, eines klar: «Allen Unkenrufen zum Trotz war die Versorgung mit Energieholz in den letzten drei Wintern ohne Preisexzesse jederzeit und überall sichergestellt.» Zwar stiegen auch die Energieholzpreise, aber deutlich weniger als die Heizöl-, Gas- und Strompreise. Die Förderung in den vergangenen Jahren und in jüngerer Zeit die Pandemie sowie der Ukrainekrieg kurbelten die Nachfrage nach Energieholz an, so dass sie in einzelnen Regionen das Angebot überstieg. Der Markt kippte 2021 nach Jahrzehnten von einem Angebots- in einem Nachfragemarkt. Holzenergie wurde zu einem Fall für die Wirtschaftliche Landesversorgung. «Wir diskutierten die Einrichtung von Pflichtlagern für Pellets und die Frage der regionalen Verfügbarkeit von Stückholz, Holzhackschnitzeln sowie Pellets. Um die Fragen zu klären und Grundlagen für eine geordnete Entwicklung des Marktes in den nächsten Jahren zu schaffen, erhielten wir den Auftrag zur Erstellung des Monitoring-Berichts Holzenergie 2023.», erläutert Andreas Keel. Der Bericht befasst sich mit drei Fragenkomplexen.
1. Wieviel Energieholz aus welchen Quellen und in welchen Sortimenten wird heute bereits genutzt? Quellen sind der Wald, die Landschaftspflege, die Holzindustrie sowie das Altholz. Sortimente sind Stückholz, Holzhackschnitzel sowie Pellets.
2. Wieviel Energieholz könnte noch zu sätzlich genutzt werden, ohne höherwertige Sortimente zu konkurrenzieren, ohne den Wald zu übernutzen und ohne namhafte Importe?
3. Wieviel Holz werden die bereits konkret geplanten Projekte sowie die bekannten Projektideen künftig brauchen?
Das Monitoring Holzenergie 2023 beleuchtet zudem Einflussfaktoren wie zum Beispiel die klimatischen, energetischen, politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese beeinflussen den Preis und damit die zur Verfügung gestellten Holzmengen und -sortimente.
Grosse regionale Unterschiede in der Schweiz
Der Monitoring-Bericht liefert detaillierte Zahlen über alle Kantone. Es stechen beachtliche Unterschiede ins Auge: In einigen Kantonen ist der Verbrauch schon heute grösser als das vorhandene Potenzial. Andernorts besteht noch viel Luft nach oben. Dies sollte einen Einfluss auf die Verteilung und Grösse neuer Holzenergieprojekte haben. Denn es macht wenig Sinn, neue Anlagen dort zu bauen, wo bereits mehr Energieholz genutzt wird als zur Verfügung steht. Eine geschickte Strategie verhindert lange Transporte und Mangellagen in Extremsituationen. «Wir müssen damit rechnen, dass wir Mangellagen künftig nicht einfach mit Importen aus dem Ausland kompensieren können, da die anderen Länder im Rahmen der Energiewende ihr Holz selber brauchen werden», gibt Andreas Keel zu bedenken.
Der Wald bietet mit fast 900’000 m3 noch die grösste zusätzlich nutzbare Holzmenge. Das gesamte, zusätzlich nutzbare Wald-, Landschafts- und Altholzpotenzial liegt bei 1,28 Millionen Kubikmeter. «Wenn wir das Energieholz noch effizienter nutzen, erhöht sich das Potential entsprechend. Es hat noch genug Holz für alle heute vorhandenen Projekte und Projektideen. Dabei ist aber darauf zu achten, dass wir die Absatzkanäle priorisieren, denn gewisse Anwendungen machen weniger Sinn», betont Andreas Keel. Er erhält für diese Aussage Unterstützung von der Politik.
Postulat von Roger Nordmann will Prioritäten setzen
Das am 23. Januar von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates eingereichte Postulat «Nordmann» beauftragt den Bundesrat, eine Strategie zur Optimierung der Nutzung der Ressource Holz in der Schweiz vorzuschlagen. Dabei geht es vor allem um zwei Aspekte:
1. Erhöhung und Rationalisierung der Nutzung der Ressource Holz in der Schweiz, unter Berücksichtigung des Waldrechtes und der Artenvielfalt
2. Optimierung der Holznutzung bezüglich Geografie, Technologie und Jahreszeit mit dem Ziel, einen breiteren Bedarf abdecken zu können, insbesondere im Bereich des Heizens.
Dabei soll es um drei Schwerpunkte gehen. Erstens um duale Fernwärmesysteme, die im Sommer und in den Übergangsjahreszeiten andere Wärmequellen wie Wärmepumpen oder solarthermische Anlagen nutzen, zweitens um die Förderung der Entwicklung holzbetriebener Blockheizkraftwerke sowie drittens um direkte Anreize zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, die bereits über ein Holzheizsystem verfügen.
Konkret bedeutet dies: Erste Priorität haben die Effizienzsteigerungsmassnahmen sowie die dezentrale Nutzung in kleinen und mittleren Anlagen bis maximal fünf, in besonderen Fällen (Blockheizkraftwerke) bis zehn Megawatt Leistung. Sehr grosse Anlagen (mehr als 10 MW Leistung) sind zu vermeiden, da sie lange Holztransportwege verursachen und «Klumpenrisiken» darstellen. Pelletheizungen sollten eine Leistung von 1000 kw nicht übersteigen. «Die Diskussionen, die wir im Rahmen der Verwendungsstrategien und des Monitorings seit 2021 führen, haben glücklicherweise dazu geführt, dass einige sehr grosse Projektideen fallengelassen oder deutlich verkleinert wurden.», fasst Andreas Keel die Situation zusammen und macht auch zur Optimierung konkrete Aussagen: «Mittel- und langfristig lässt sich mit Effizienzsteigerungen und Optimierungen der bestehenden Holzheizungen und Nahwärmenetze deren Holzverbrauch um zehn bis 15 Prozent vermindern, was etwa 0,3 bis 0,5 Millionen Kubikmeter für zusätzliche Anwendungen ‹freispielen› würde. Die intelligente Integration zusätzlicher Energiequellen wie Photovoltaik/Wärmepumpen oder thermische Solaranlagen in bestehende Anlagen könnten den Holzverbrauch – vor allem im Sommerhalbjahr – zusätzlich senken, vielleicht um 0,5 Millionen Kubikmeter. Dadurch steigt das für zusätzliche Heizungen nutzbare Potential insgesamt auf gut zwei Millionen Kubikmeter.» Es hat also tatsächlich noch recht viel Luft nach oben und die Holzenergie kann auch in den nächsten Jahren einen wichtigen Beitrag an die Energiewende leisten.
(PD)
Verband Holzenergie Schweiz
Der Branchenverband Holzenergie Schweiz betreibt seit 1979 einen professionellen Informations- und Beratungsdienst und setzt sich bei Behörden und Entscheidungsträgern für eine vermehrte Nutzung der «Wärme aus dem Wald» ein.
Weitere Informationen unter:
www.holzenergie.ch